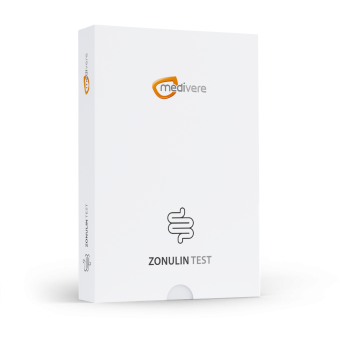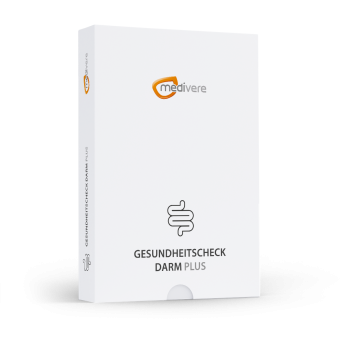Was ist das Leaky Gut Syndrom? Symptome und Behandlung
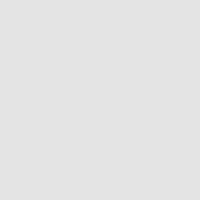
Das Leaky-Gut-Syndrom
Nährstoffe, Schadstoffe, potenziell gefährliche Bakterien, Wasser… Täglich nehmen wir eine Vielzahl von Stoffen und Keimen mit unserer Nahrung auf. Im Darm wird selektiert, welche davon in den Blutkreislauf gelangen – und welche lieber wieder ausgeschieden werden. Doch was, wenn diese natürliche Barriere undicht wird und ein Leaky-Gut-Syndrom entsteht?
Der Darm, ein Organ mit lebenswichtigen Aufgaben
Der Magen-Darm-Trakt stellt die größte Grenzfläche des menschlichen Körpers zur Außenwelt dar. Durch zahlreiche Auffaltungen und Ausstülpungen erreicht die Darmschleimhaut, die den Darm von innen auskleidet, selbst auf kleinem Raum eine enorme Oberfläche von etwa 300 m². Die starke Oberflächenvergrößerung dient der möglichst effizienten Bewältigung der Hauptaufgabe des Darms: Der Aufnahme von Nährstoffen und Wasser. Durch Aufspaltung der Nahrung bis hin zu kleinsten Nahrungsbestandteilen werden die Nährstoffe freigesetzt; diese Aufspaltung der Nahrung wäre kaum möglich ohne Mikroorganismen wie Bakterien, die den menschlichen Darm, vor allem den Dickdarm, zu Billionen[i] besiedeln. Die Gesamtheit dieser Darm-Mikroorganismen bezeichnet man als Darmflora. Die Zusammensetzung der Darmflora hat, wie man heute weiß, nicht nur Auswirkungen auf die Verdauungsleistung, sondern auch auf Gesundheit und Wohlbefinden.
Neben seiner Hauptfunktion, der Nährstoff- und Wasseraufnahme, spielt der Darm auch eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr, denn der Magen-Darm-Trakt kommt ständig mit potenziell gefährlichen Keimen aus der Außenwelt in Kontakt. Geschützt wird der Organismus durch den vielschichtigen Aufbau des Darms. Zur Abwehr potenziell schädlicher Keime trägt neben einer besonders hohen Konzentration an Immunzellen auch die Darmflora und die Darmschleimhaut bei.
Kasten: Während Nährstoffe die Darmschleimhaut passieren können, müssen unzureichend aufgespaltene Nahrungsbestandteile, potenziell allergieauslösende Stoffe (Allergene), bakterielle Giftstoffe und andere Schadstoffe zurückgehalten werden.
Die Barrierefunktion der Darmschleimhaut
Der spezielle Aufbau des Darms bildet eine Barriere für potenziell schädliche Stoffe und Nahrungsbestandteile. Er besteht aus einer einlagigen Schicht von Darmschleimhautzellen (Enterozyten), welche die Innenseite des Darms auskleidet (Abbildung 1). Sie sind mit Schleim bedeckt und bilden zusammen die Darmmukosa, auf dem die Mikroorganismen der Darmflora angesiedelt sind. Die einzelnen Darmschleimhautzellen sind durch Proteine fest miteinander verkittet; diese Verkittungen werden Tight Junctions genannt. Stoffe aus dem Darminnenraum, welche die Schleimschicht überwunden haben, können sowohl durch die Darmschleimhautzellen hindurch transportiert werden als auch an den Darmschleimhautzellen vorbei durch die Tight Junctions. Beide Transportwege sind im gesunden Darm streng reguliert, damit möglichst keine schädlichen Substanzen aus dem Darm übertreten können, aber andererseits die Aufnahme von Nährstoffen optimiert wird.
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Aufbaus der Darmwand
Wenn der Darm undicht wird: Das Leaky-Gut-Syndrom
Ist diese Barrierefunktion jedoch gestört, können Schadstoffe, Allergene und Krankheitserreger vermehrt in den Blutkreislauf gelangen - man spricht dann von einem Leaky-Gut-Syndrom (engl. leaky gut = „undichter Darm“; Abbildung 1). Stoffe, welche die Darmschleimhaut unkontrolliert überwinden, kommen mit dem Immunsystem des Darms in Kontakt und können so z. B. Entzündungen im Bereich der Darmschleimhaut verursachen. Darüber hinaus können sie das Immunsystem auch sensibilisieren und zur Bildung von Antikörpern führen – auch gegen Nahrungsbestandteile.
Doch was sind die Ursachen eines „leaky gut“?
Die Barrierefunktion von Darmschleimhautzellen und Tight Junctions kann durch verschiedene Störfaktoren beeinträchtigt werden. Zu diesen zählen:
- Stress
- Medikamente
- Alkohol
- Nikotin
- bestimmte Mikroorganismen (z. B. darmschädigende Varianten des Bakteriums E. coli)
- bakterielle Giftstoffe (insbesondere ein Giftstoff des Bakteriums Clostridium perfringens)
- körpereigene entzündungsfördernde Substanzen
Chronischer Stress hat großen Einfluss auf die Darmgesundheit. Durch Stress verursachte Darmproblematiken, wie etwa das Reizdarm-Syndrom, können einerseits eine Folge, andererseits aber auch eine Ursache einer gestörten Darmbarriere sein. Chronischer Stress fördert außerdem entzündliche Prozesse - auch im Bereich des Darms, welche zu einem „leaky gut“ beitragen können. Die Reduktion stressauslösender Faktoren kann daher ein wichtiger Baustein bei der Therapie eines Leaky-Gut-Syndroms sein.
Auch die Ernährung kann eine wichtige Rolle spielen: Neuere Studien weisen darauf hin, dass das in Weizen vorkommende Protein Weizenkeim-Agglutinin (WGA) eine schädigende Wirkung auf die Darmschleimhaut besitzt und ihre Durchlässigkeit erhöht; liegt bereits eine Schädigung der Darmschleimhaut und ihrer Barrierefunktion vor, z. B. im Rahmen eines schon vorhandenen Leaky-Gut-Syndroms, kann sich dieser Effekt noch verstärken.
Welche Symptome macht das Leaky-Gut-Syndrom und was sind die Folgen für den Patienten?
Die Symptome können bei den Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt sein und ähneln oft denen eines Magen-Darm-Infektes:
• Durchfall
• Bauchschmerzen & Bauchkrämpfe
• Übelkeit & Erbrechen
• Sinkende Leistungsfähigkeit
• Müdigkeit & Schlappheit
Da Nährstoffe nicht mehr effektiv aus der Nahrung aufgenommen werden können, entsteht bei den Betroffenen oft ein Nährstoffmangel, der zum genannten Leistungsverlust führt. An verschiedenen Stellen des Körpers können Entzündungen auftreten, die gar nicht unmittelbar mit dem Darm in Verbindung gebracht werden.
Die gestörte Barrierefunktion der Darmschleimhaut kann ernste gesundheitliche Folgen nach sich ziehen:
- Unzureichende Nährstoffaufnahme
- Nahrungsmittelunverträglichkeiten (unphysiologisch hohe IgG-Freisetzung gegen Nahrungsmittelproteine)
- Nitrosativer Stress
- Autoimmunreaktionen (Immunreaktionen gegen körpereigene Strukturen), wenn aufgenommene Stoffe körpereigenen Strukturen ähneln und das Immunsystem gegenüber diesen sensibilisieren - „leaky gut“ gilt als eine Grundlage für Zöliakie, rheumatoide Arthritis und Multiple Sklerose
- Entzündungsreaktionen im Bereich des Darms - „leaky gut“ steht in Zusammenhang mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
- Systemische (körperweite) Entzündungsreaktionen, wenn Bakterien oder deren Stoffwechselprodukte in den Blutkreislauf gelangen – mit chronischen Infektionen, Herz-Kreislauf-Störungen und Allergien als mögliche klinische Folgeerscheinungen
- Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas (Fettleibigkeit), Diabetes mellitus Typ 2 oder nicht-alkoholische Fettleber
- Reizdarm-Syndrom
Zonulin, ein Regulator der Darmbarriere
Die Durchlässigkeit der Tight Junctions, welche die Darmschleimhautzellen miteinander verkitten, ist auch im gesunden Darm nicht statisch, sondern wird reguliert. Der wichtigste Regulator ist hierbei Zonulin, ein Stoff, der von den Darmschleimhautzellen selbst produziert und in den Darminnenraum ausgeschüttet wird. Zonulin wirkt wiederum auf die Oberfläche der Darmschleimhautzellen ein. Darauf reagieren diese, indem sie die Durchlässigkeit der Tight Junctions erhöhen, die Tight Junctions also „lockern“. Studien der letzten Jahre deuten darauf hin, dass eine erhöhte Zonulin-Ausschüttung in kausalem Zusammenhang mit einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere steht.
Über das normale Maß hinaus können bestimmte Zustände die Zonulin-Produktion ankurbeln: Dazu zählen zum Beispiel Entzündungen des Darms oder auch eine Dysbiose, eine Störung der normalen Artenzusammensetzung der Darmflora. Eine derart gestörte Darmbarriere begünstigt die Auslösung entzündlicher Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis.
Wie können die Ernährung und ein gesunder Lebensstil den Zonulin-Spiegel verringern?
Umgekehrt gibt es jedoch auch Stoffe, welche zu einer Senkung des Zonulin-Spiegels beitragen können. Zu diesen zählt die kurzkettige Fettsäure Butyrat, welche von bestimmten Darmbakterien bei der Verwertung löslicher Ballaststoffe freigesetzt wird. Somit lässt sich einerseits über eine ballaststoffreiche Ernährung, andererseits über eine gezielte Beeinflussung der Darmflora durch prä- und probiotische Kost eine gesunde Barrierefunktion der Darmschleimhaut unterstützen. Insbesondere Vertreter des Bakterienstammes Firmicutes sowie Bifidobakterien zeigen sich wirksam. Auch zur Bekämpfung einer bestehenden Dysbiose, welche die Darmbarriere stören kann, haben sich Probiotika – im Speziellen das Milchsäurebakterium Lactobacillus casei – als wirksam erwiesen.
Eine Nahrungsergänzung mit Vitamin A, Vitamin D oder Colostrum bovinum zeigte in Studien einen stärkenden Effekt auf die Tight Junctions und kann sich somit positiv auf die Stabilität der Darmbarriere auswirken.
Ebenso können Strategien zur Stressbewältigung und Vermeidung von übermäßigem Alkoholkonsum zur Senkung der Zonulin-Spiegel beitragen.
Kasten: Für die Darmgesundheit gilt generell eine ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde Ernährung aus frischen Lebensmitteln mit viel Obst und Gemüse als ideal. Es sollte gleichzeitig auf stark verarbeitete Lebensmittel und Lebensmittel mit einer ungünstigen Fettsäurezusammensetzung verzichtet werden.
|
Mehr von |
Weniger von |
|
Kaltgepresste Öle |
Wurst oder Speck |
|
Fisch mit hohem Omega-3-Anteil wie Lachs oder Hering |
Backwaren wie Kuchen oder Pizza
|
|
Vollkornprodukte |
Fast Food wie Pommes, Hot Dogs oder Hamburger |
|
Hülsenfrüchte |
Raffinierte Öle |
|
Obst und Gemüse |
Künstliche Süßungsmittel und Aromen |
|
|
Alkohol |
Beurteilung der Durchlässigkeit der Darmschleimhaut durch Bestimmung des Zonulin-Wertes im Stuhl
In der Routinediagnostik dient Zonulin als Parameter zur Beurteilung der Barrierefunktion der Darmschleimhaut. Eine Zonulin-Bestimmung kann beispielsweise der Verlaufskontrolle einer Zonulin-senkenden Therapie dienen. Sie ist außerdem angezeigt bei folgenden Erkrankungen:
- Autoimmunerkrankungen, insbesondere Zöliakie
- Insulinabhängiger Diabetes mellitus
- Multiple Sklerose
- Rheumatoide Arthritis
Medivere bietet ein Testverfahren zur Zonulin-Bestimmung im Stuhl an.
Die Zonulin-Bestimmung ist außerdem Teil der folgenden Testpakete zur Beurteilung der Darmgesundheit:
- Gesundheitscheck Darm Plus Stuhltest: Dieses Testpaket umfasst die Beurteilung des Zustandes der Darmflora, der Verdauungsleistung sowie des Zustandes und der Funktion der Darmschleimhaut und des darmassoziierten Immunsystems.
- Darm-Mikrobiom Plus Stuhltest: Neben einer Prüfung der Parameter des Gesundheitscheck Darm Plus Stuhltests beinhaltet der Darm-Mikrobiom Plus Stuhltest eine Analyse der Darmflora mittels DNA-Sequenzierung. Diese Methode erlaubt die Erkennung beinahe aller bekannten Bakterienarten und erlaubt damit Rückschlüsse über die Artenvielfalt, die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Bakterienstämme und mögliche Dysbiosen des Darms.
[i] https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Probiotika-und-Praebiotika-Darmflora-aufbauen,darmgesundheit100.html /Madigan, Martinko, Dunlap, Clark: Brock Biology of Microorganisms. Pearson International Edition, 12th edition, 2009, S. 818